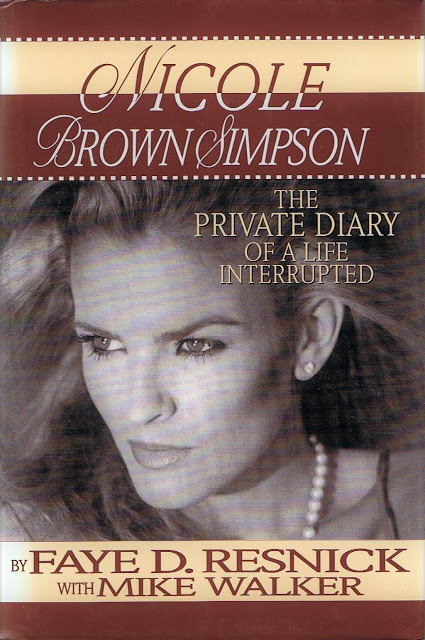Charmantes Singer/Songwriter-Album – nach mehrfachem Hinhören.
Mist. Eigentlich saßen die Finger schon auf der Tastatur, bereit in den Startlöchern, das Debütalbum von A Fine Frenzy zurechtzustutzen. Wie es grad schwer im Trend liegt, zeigt uns das Booklet ein niedliches, verträumtes Mädchen, bei dem sich Mann auch mal trauen würde, nach der Telefonnummer zu fragen; das in bunten Kleidern durch Wald und Wiese läuft, und dabei so aussieht, als würde es jeden Moment in fröhlicher Verzückung Flora und Fauna umarmen. Auf der CD ganz viel Singer/Songwriter-Wohlklang mit der netten Frau am Piano, viel Naturpoesie in den Texten, aber wenig Aufregung in Sachen Energie, ein bißchen viel Produktion über ein bißchen wenig an Substanz. Die Nächste, bitte.
Aber halt: Bei der nächsten Begegnung gerät der Vorsatz ins Schwanken. Und dann wird einem das Album auf einmal sympathisch, blüht ein wenig auf, zeigt seine Stärken in einer Handvoll feiner Songs im Mittelteil. Alison Sudol, das 22jährige Mädchen, das sich hinter der Shakespeare-Phrase „A Fine Frenzy“ versteckt, hat viel Dynamik in ihrer erfreulich unaffektierten Stimme und klingt beim Singen meist so, als würde sie einem jetzt etwas sehr Persönliches erzählen. Wo die Melodien der Songs anfangs nirgendwo hinzugehen scheinen, macht sich bei mehrmaligem Anhören eine fast wellenartige Auf- und Abbewegung bemerkbar, die von einer attraktiven Ruhe zeugt. Es stimmt schon: Nicht jeder Song hat genug Substanz, aber viele haken sich erst nach mehrmaligem Abspielen ganz sachte fest. Hier schiebt nichts an, hier kann man nur selber mitgehen, wenn man mag.
Die Produktion badet alles in schönem Klang und versteht den Fluß von Sudols Songs – und läßt dabei eigentlich doch meist genug Luft, obwohl man beim ersten Mal alles ein bißchen viel findet. Ein paar ungewöhnlichere Klänge – wie die Sitar auf „Last of Days“ – sind so sanft und subtil in den Mix eingearbeitet, daß man sie kaum wahrnimmt. Das ist einerseits schön – weil so die Songs nicht von Gimmicks beherrscht werden – aber andererseits auch schade, da sich die 14 Tracks so ähnlich klingen, daß ein paar andere Klangtexturen mitunter nicht schaden würden. Am auffälligsten ist da noch das Akkordeon auf „Liar, Liar“.Der beste Part der CD ist ein Trio von drei Songs in der Mitte: das abgespeckte „Almost Lover“, gleichzeitig die Single, und danach „Think of You“ und „Ashes and Wine“. Auch davor und danach funktionieren manche Songs besser als andere: „You Picked Me“ erinnert ganz entfernt an „Kiss Me“ von Sixpence None the Richer; hinten sticht das charmante „Lifesize“ heraus.
Um die Feinheiten herauszuhören und die Songs einordnen zu können, muß man sich aber ein wenig in die CD hineinhören. Nichts an der Musik ist schwierig oder sperrig, aber ebenso ist nichts daran besonders auffällig. Ob man sich die Zeit nehmen mag, hängt von einem selbst ab – zu finden ist dann nach einiger Zeit zwar nicht mehr Substanz, aber dafür ein charmantes Singer/Songwriter-Album. Sie ist ja auch erst 22.
Dieser Text erschien zuerst am 11.3.08 bei Fritz!/Salzburger Nachrichten.
—————–
4 8 15 16 23 42